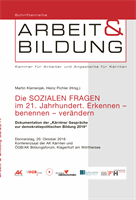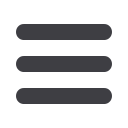

19
Politische Bildung
57
für alle zu ermöglichen und dabei die natürlichen Lebensgrundlagen
für zukünftige Generationen zu wahren. Zur konkreten Umsetzung
wurden 17 Nachhaltigkeitsziele (SDG) ausgearbeitet. Diese Ziele
sind dezidiert als universelle Ziele definiert, die Industrie-, Schwellen-
und Entwicklungsländer in die Pflicht nehmen. In dieser neuen Stra-
tegie wurden die Zielvorgaben in Bezug auf die Verringerung der welt-
weiten Armut ausgeweitet. Angestrebt wird die vollständige Überwin-
dung extremer Armut. Dabei wird auch die jeweilige nationale Defini-
tion von Armut in den Blick genommen, die ebenfalls realitätsnäher
ist als die Messung der Weltbank und dementsprechend höhere
Armutszahlen aufweist. Die Zielvorgaben der Agenda sind dann nicht
mehr auf die Länder des globalen Südens beschränkt, sondern der
Anteil der Männer, Frauen und Kinder, die nach der jeweiligen natio-
nalen Definition in Armut leben, soll in jedem Land halbiert werden.
Armut und wachsende Ungleichheit sind mehr als soziale Probleme,
sie bilden den Nährboden für globale Risiken und ökologische Ge-
fährdungen und sind vorrangig in ihren Ursachen zu bekämpfen. We-
der internationale Hilfsprogramme noch Spendensammlungen wer-
den dieser Aufgabe gerecht.
Jenseits von Entwicklungshilfe und Almosen
–
so der Titel des Workshops bei den „Kärntner Gesprächen zur de-
mokratiepolitischen Bildung“. Der Titel weist darauf hin, dass die glo-
balen sozialen Fragen im 21. Jahrhundert weit jenseits der Gestal-
tungsmöglichkeiten von internationaler Entwicklungszusammenarbeit
liegen. Die Verringerung von Armut, Hunger und Mangelernährung
oder der Ausbau von Gesundheitsversorgung und Bildungschancen
haben weiterhin oberste Priorität für die internationale (staatliche und
private) Entwicklungszusammenarbeit. Allerdings hatte die globale
Wirtschafts- und Finanzkrise letztlich auch Auswirkungen auf die
Finanzierung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. So
haben etwa die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten immer
wieder versichert, dass sie die Quote der öffentlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit (ODA – Official Development Assistance) auf 0,7
Prozent des Bruttonationalprodukts erhöhen werden. „Trotz eines
realen Anstiegs der von der EU geleisteten ODA von fast 40 Prozent
seit 2002 ist dieses Ziel aufgrund der Wirtschaftskrise und großer
Haushaltszwänge in den meisten EU-Mitgliedstaaten bisher nicht
erreicht“. (Europäische Kommission 2015, o. S.) Trotzdem waren die
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auch 2015 der weltweit
größte Geber von Entwicklungshilfe. Mit insgesamt 68 Milliarden Euro