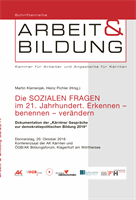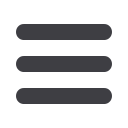

Politische Bildung
48
Globale Verflechtungen
Die oben skizzierten und viele weitere Bedrohungsszenarien für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt treten jedoch selten alleine auf,
sondern sind häufig kausal oder interdependent miteinander ver-
knüpft, und in vielen Fällen erreichen diese Verflechtungen globale
Dimensionen. Denken wir beispielsweise an die Folgen, die unsere
„imperiale Lebensweise“, wie es Markus Wissen und Ulrich Brand
unlängst bezeichneten (Wissen/Brand 2017), hinsichtlich de
m
Wunsch
nach Rohstoffen und billigen Konsumgütern, anderorts in ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Hinsicht mit sich bringen. Aus die-
ser Perspektive lässt sich den Gedanken des Politologen Ivan
Krastev durchaus etwas abgewinnen, wenn er das omnipräsente
Phänomen der Migration als eine „neue Revolution“ bezeichnet: „Für
eine wachsende Zahl von Menschen bedeutet Veränderung nicht
mehr, die Regierung zu wechseln, unter der sie leben, sondern das
Land zu wechseln, in dem sie leben“. (Krastev 2017, S. 129.)
Vor diesem Hintergrund Lösungsstrategien ausschließlich aus natio-
nalstaatlichen Deutungrahmen zu entwickeln, ist angesichts der glo-
balen Zusammenhänge nicht nur antiquiert, sondern langfristig ge-
fährlich. Um es an dieser Stelle bewusst pointiert zu formulieren: Wer
die für Europa stellt, muss sie konsequenterweise auch für die Welt
stellen. Denn entscheidend ist, wie es der bekannte amerikanische
Evolutionsbiologe Jared Diamond formulierte, „[d]ie Reaktionen einer
Gesellschaft erwachsen aus ihren politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Institutionen sowie aus ihren kulturellen Werten (…), ob die
Gesellschaft ihre Probleme lösen kann.“ (Diamond 2006, S. 29) –
oder
aber auch sie erst gar nicht entstehen lässt.
Was hält die Gesellschaft zusammen?
Als zweiter wesentlicher Punkt, der eine breitere Auffassung der
„Sozialen Frage“ mit sich bringt, ist der komplementäre Fokus auf die
Grundbedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens anzu-
führen. Auf welchen Fundamenten fußt diese
s
überhaupt? Die Wis-
sen schaft liefert hierfür zahlreiche Erklärungsmodelle: Häufig wird die
Vorstellung eines gesellschaftlichen Grundkonsenses tradiert, der in
unterschiedlicher Ausprägung und Intensität vorhanden sein kann.
Dieser Konsens kann sich beispielsweise über eine gemeinsame
Sprache oder Kultur ergeben, durch eine Verfassung oder Staats-
gründung hergestellt werden oder durch die Berufung auf gemeinsa-
me universalistische Werte, wie z.B. die Menschenrechte, entstehen.
(Hradil 2013, S. 22 ff.). Andere sehen den Zusammenhalt vor allem