
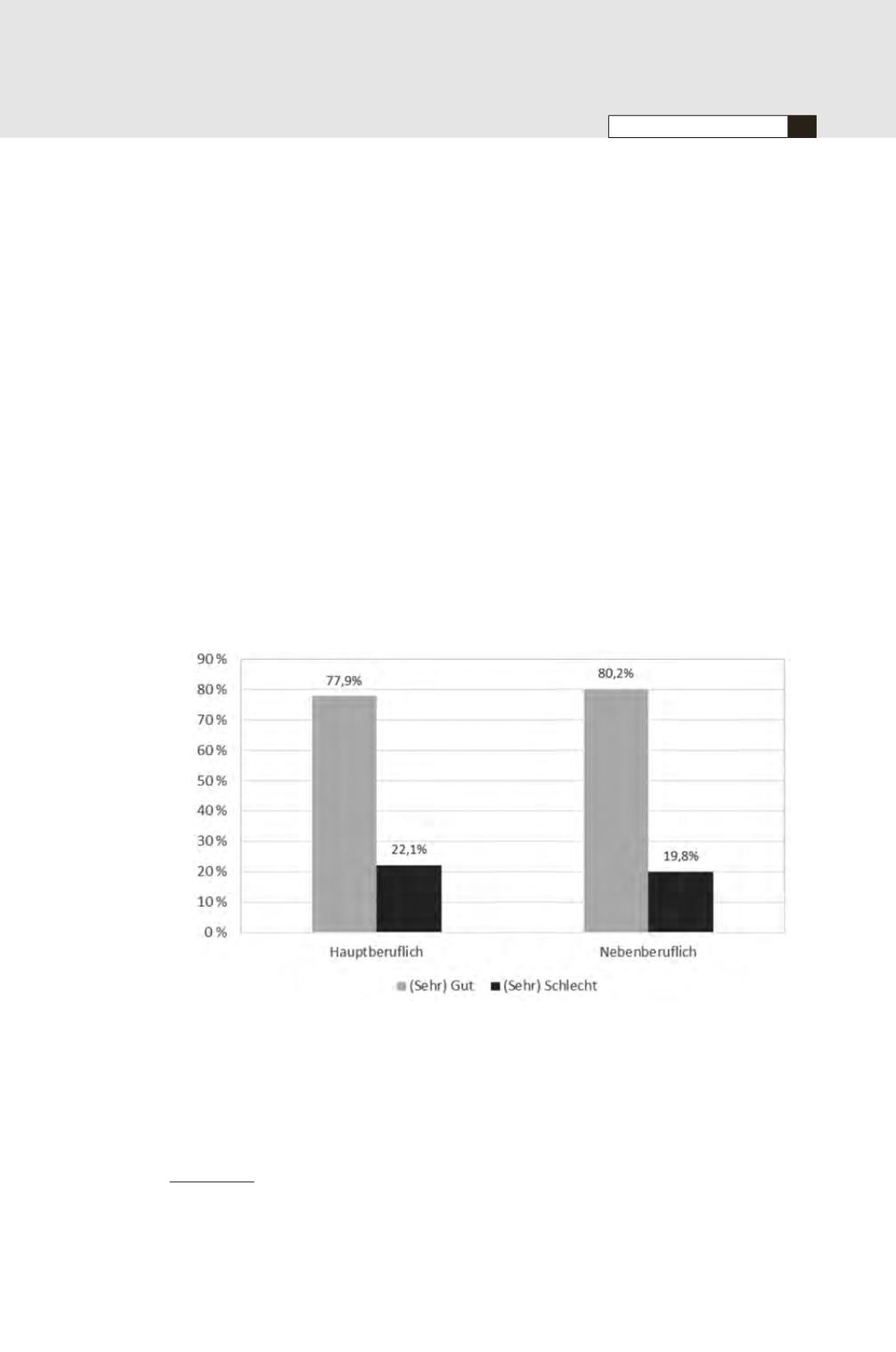
bensbereiche wie etwa Familie, Freunde, soziales Engagement etc.
(vgl. Wiese, 2015).
49
Wie bereits zuvor bei der Analyse der Zufriedenheit mit der Tätigkeit
als Trainer/in und ausgewählten Teilaspekten, wurde das subjektiv
empfundene Bewertungsverhältnis zwischen Arbeit und Freizeit
auch an dieser Stelle auf einer 4-stufigen Likert-Skala von „1 = sehr
gut“ bis „4 = sehr schlecht“ erhoben und stellte eine Pflichtfrage
dar. Die Auswertung differenziert nach Tätigkeitsumfang (vgl. Abbil-
dung 64) zeigt einerseits, dass mit einem Anteil von 77,9 % unter
den Hauptberuflichen bzw. 80,2 % unter den nebenberuflichen Trai-
nier/innen das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit „(sehr) gut“
bewertet wird. Anderseits zeigt ein Rangsummentest nach Mann-
Whitney-U, dass keine statistisch signifikanten Unterschiede in Ab-
hängigkeit vom Tätigkeitsumfang bestehen (z =
-
0,409; p = 0,682;
n = 210).
Abbildung 64: Bewertung der Work-Life-Balance nach
Tätigkeitsumfang
(in %; n = 210)
Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung
Die Auswertung der Bewertung der Work-Life-Balance getrennt
nach Geschlecht zeigt ein sehr ausgeglichenes Bild. Männer bewer-
teten ihre Work-Life-Balance mit 79,4 % geringfügig besser als
Frauen (78,8%); statistisch signifikant ist – auf Basis eines Mann-
19
Politische Bildung
8
49)
An dieser Stelle sei auf weiterführende Studien verwiesen, die sich mit der Work-Life-
Balance von Personen in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigen (
vgl.
Resch &
Bamberg,
2005) oder mit jener von Frauen und Männern in hochqualifizierten Berufen
(
vgl.
Hoff et al., 2005).
















